Bei einer Schnarcherschiene (Synonyme: Unterkieferprotrusionsschiene, UPS; Schnarchtherapiegerät; engl.: "mandibular advancement device", MAD) handelt es sich um ein therapeutisches Gerät, das durch Protrusion (Vorverlagerung) des Unterkiefers die oberen Atemwege erweitert, wodurch Schnarchgeräusche verhindert und Apnoezustände (Atemaussetzer) behandelt werden.
Mithilfe einer Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) kann die Tagesschläfrigkeit von Patientinnen und Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom (OSAS) gelindert werden. Das OSAS ist gekennzeichnet durch die Obstruktion (Verengung) oder komplettem Verschluss der oberen Atemwege während des Schlafes.
Das Gerät besteht aus jeweils einer transparenten, starren Kunststoffschiene für den Ober- und Unterkiefer. Beide Schienen sind durch im bukkalen Mundvorhof (Raum zwischen Wangen und Zähnen) oder interokklusal (zwischen den Zahnreihen) positionierte Metall- oder Kunststoffstege miteinander verbunden, die dem Unterkiefer zwar etwas seitliche Bewegungsfreiheit lassen, ihn aber in einer nach ventral (vorne) verlagerten Position fixieren.
Im Schlaf lässt die Muskelspannung des Körpers nach, also auch der Tonus (Spannungszustand) der Rachen- und Zungenmuskulatur. Begünstigt durch eine Rückenlage des Schlafenden fällt die Zunge zurück und engt somit die Luftwege zwischen Zunge und Rachenwand ein. Durch den eingeengten Luftstrom entstehen durch Flattern der Weichgewebe, so z. B. des Gaumensegels, die typischen, bis zu 90 Dezibel lauten Schnarchgeräusche, die für den Schnarcher selbst nicht gesundheitsschädigend sind, sehr wohl aber die Schlafqualität des Partners erheblich reduzieren können.
Kommt es jedoch nicht nur zur Einengung der oberen Atemwege, sondern zu einem völligen Verschluss, sind obstruktive Apnoezustände (Atemstillstand durch Verschluss) die Folge, in denen die Atmung zwischen zehn Sekunden und zwei Minuten aussetzen kann, bevor das Gehirn den entstehenden Sauerstoffmangel mit einer Weckreaktion beendet. Treten die Atemaussetzer regelmäßig und häufig auf, werden die für einen erholsamen Schlaf wichtigen Tiefschlafphasen erheblich reduziert, was schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen kann.
Indikationen (Anwendungsgebiete)
Der Einsatz einer Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) gilt gemäß dem nationalen Konsensuspapier bereits bei leichter bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe (OSAS) und einem Body-Mass-Index (BMI) < 30 kg/m2, besonders bei überwiegend in Rückenlage auftretender Schlafapnoe, neben der Positivdruckatmung als Therapie der ersten Wahl [3]. Hierbei sollte die Diagnostik vorab interdisziplinär durch den HNO-Arzt, Internisten oder Lungenfacharzt sowie ein Schlaflabor erfolgen.
In schwerwiegenderen Fällen können operative Maßnahmen oder eine nächtliche Überdruckbeatmung mit einem nCPAP ("continuous positive airway pressure", Überdruckbeatmungsgerät; nCPAP-Maske n=nasal) erforderlich werden. Sollte das nCPAP vom Patienten nicht akzeptiert werden, so kann die Behandlung auch hier mit einem Schnarchtherapiegerät erfolgen.
Der Herstellung des Schnarchtherapiegeräts muss eine umfassende Diagnostik der Zähne, des Kiefergelenks und der Funktionsbewegungen vorausgehen, da die Schienen sämtliche Zähne umfassen und diese durch die Schiene Belastungen ausgesetzt sind; außerdem darf die Vorschubbewegung des Unterkiefers nicht durch Erkrankungen des Kiefergelenks eingeschränkt sein.
Folgende Voraussetzungen für die Anwendung einer UPS sollten erfüllt sein:
- ausreichende Zahl fester und gesunder Zähne je Kiefer bzw. alternativ eine ausreichende Zahl von belastbaren Implantaten
- ausreichende Fähigkeit zu Mundöffnung
- unauffällige klinische Funktionsanalyse (klinische und instrumentelle Diagnoseverfahren, die Auskunft geben über den Funktionszustand des craniomandibulären Systems (Kausystems))
Kontraindikationen (Gegenanzeigen)
- Kiefergelenkerkrankungen: Patienten mit Erkrankungen des Kiefergelenks sollten keine Schnarcherschiene verwenden, da diese die Kiefergelenke belastet.
- Zahnerkrankungen: Vorhandensein von Parodontitis oder anderen schwerwiegenden Zahnerkrankungen, die eine stabile Fixierung der Schiene verhindern.
- Unzureichende Zahnanzahl: Eine unzureichende Anzahl von gesunden Zähnen kann die Anwendung einer Schnarcherschiene erschweren.
- Fortgeschrittene Prothesenträger: Vollständige Zahnprothesen oder umfangreiche zahnärztliche Arbeiten können die Anpassung und Wirksamkeit der Schiene beeinträchtigen.
Vor der Therapie
- Diagnostik: Vor der Anpassung einer Schnarcherschiene sollte eine ausführliche Diagnostik durch einen Zahnarzt oder Kieferorthopäden erfolgen. Dazu gehören eine Untersuchung der Zähne, des Kiefergelenks und der Funktionsbewegungen des Kiefers.
- Abformung und Konstruktionsbissnahme: Für die Anpassung werden Abformungen von Ober- und Unterkiefer gemacht und ein Konstruktionsbiss zur Bestimmung der optimalen Unterkieferposition genommen.
Das Verfahren
Die Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) wird von einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden angepasst; dazu erfolgt:
- Abformung von Ober- und Unterkiefer
- Konstruktionsbissnahme: Ober- und Unterkiefer werden durch eine Wachsbissnahme oder einen anderen Transferbehelf in einer vorverlagerten Position des Unterkiefers zueinander in Lagebeziehung gebracht. Dadurch wird garantiert, dass die Zunge durch das Gerät am Zurückfallen gehindert wird. Der Unterkiefer wird dabei in einer Position fixiert, die 50 % des maximal möglichen Vorschubs beträgt. Zudem wird bei der Registrierung die okklusale Sperrung (erforderlicher Abstand zwischen den Zahnreihen) festgelegt.
- Schienenherstellung: im zahntechnischen Labor; dabei handelt es sich um stabile, transparente, in Tiefziehtechnik hergestellte Kunststoffschienen, welche die Zahnkronen bedecken, nicht jedoch Weichgewebsanteile des Mundes wie Gingiva (Zahnfleisch) oder Gaumen. Die grazile Gestaltung trägt zum Tragekomfort bei und engt den Mundraum so wenig wie möglich ein.
- Im bukkalen (Raum zwischen Wangen und Zähnen) oder interokklusalen (zur Wange hin oder zwischen den Zahnreihen gelegenen) Bereich der Schienen werden die Verbindungsstege positioniert.
- Eingliedern der Schiene: im Patientenmund ist bei teleskopartigen Metallstegen noch eine Feinjustierung der Unterkieferposition möglich.
In jedem Fall muss der Patient mit einer Eingewöhnungsphase rechnen, deren Begleiterscheinungen wie vermehrter Speichelfluss, Druck an den Zähnen oder Muskelverspannungen durch konsequentes Tragen zurückgehen sollten.
Nach der Therapie
- Eingewöhnungsphase: Die Eingewöhnung an die Schiene kann mit Nebenwirkungen wie vermehrtem Speichelfluss, Druck an den Zähnen oder Muskelverspannungen einhergehen.
- Verlaufskontrolle: Eine regelmäßige Überprüfung der Schiene durch einen Zahnarzt ist erforderlich, um Anpassungen vorzunehmen und Nebenwirkungen zu kontrollieren.
- Zusätzliche Empfehlungen: Gewichtsreduktion, Vermeidung von Alkohol und Tabak sowie eine bevorzugte seitliche Schlafposition können zusätzlich helfen, die Symptome zu lindern.
Mögliche Nebenwirkungen
- Initial und temporär: vermehrter Speichelfluss, Mundtrockenheit; Schleimhautirritationen; Muskelschmerzen; Druckgefühl an Zähnen und Kiefergelenk
- Wg. permanenter dentaler Fixierung übertragen sich zwangsläufig reziproke Kräfte auf das stomatognathe System (Gesamtheit des Zahn-, Mund- und Kiefersystems), insb. im Schneidezahnbereich; mögliche Folge sind dadurch geringe Zahnstellungsanomalien, die zu Veränderungen der Frontzahnrelationen und eine Minderung der Okklusionskontakte (Kontakt zwischen den Zähnen des Oberkiefers und des Unterkiefers) im Prämolarenbereich (vordere Backenzähne) führen können.
- Okklusionsstörungen (in Einzelfällen)
- Gelenkgeräusche
Weitere Hinweise
- Eine Netzwerk-Metaanalyse von CPAP-Therapie und Unterkieferprotrusionsschiene (Schnarcherschiene) konnte nachweisen, dass der systolische und diastolische Blutdruck signifikant zurückging [4]:
- Systolischer Blutdruck: 2,5 vs. 2,1 mmHg.
- Diastolischer Blutdruck: 2,0 vs. 1,9 mmHg
- Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen hat für die Unterkieferprotrusionsschiene (UPS) im Vergleich zu einer CPAP-Therapie bei leichter bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe bei Erwachsenen keine Nichtunterlegenheit der UPS festgestellt; gleiches gilt auch für die Tageschläfrigkeit [6]. Fazit: Die UPS ist nachweislich sehr wirkungsvoll.
Wegen Adjustierbarkeit, Compliance und möglicher Nebenwirkungen der Schienenbehandlung ist eine kontinuierliche Verlaufskontrolle erforderlich.
Literatur
- Hinz R, Rose EC, Sanner B: Schlafmedizin. Kompendium für Zahnmediziner. Zahnärztlicher Fach-Verlag 2005
- Raiman J (Hrsg): High-End Kieferorthopädie in Hannover. All Dente Verlag 2006
- Randerath WJ, Hein H, Arzt M, Galetke W, Nilius G, Penzel T et al.: Consensus paper on the diagnosis and treatment of sleep disordered breathing. Pneumologie 2014 Feb;68(2):106-23. doi: 10.1055/s-0033-1359221.
- Bratton DJ et al.: CPAP vs Mandibular Advancement Devices and Blood Pressure in Patients With Obstructive Sleep Apnea. JAMA 2015; 314(21): 2280-2293
- Weber T. (2017). Memorix Zahnmedizin (5. unveränderte Aufl.). Thieme Verlag.
- IQWiG: Unterkieferprotrusionsschiene bei leichter bis mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe bei Erwachsenen. IQWiG Abschlussbericht Nr. 881 Auftrag: N18-03, Version: 2.0, Stand: 07.05.2020
- Kirch B. (2022). Die Schienentherapie in der zahnärztlichen Praxis (2. Aufl.). Spitta GmbH (Verlag)






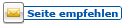




 DocMedicus Arztsuche
DocMedicus Arztsuche DocMedicus
DocMedicus Newsletter
Newsletter  DocMedicus Expertenrat
DocMedicus Expertenrat



